Fließband, adieu!
Plädoyer für eine ökologische Industriepolitik
von Jean Gadrey
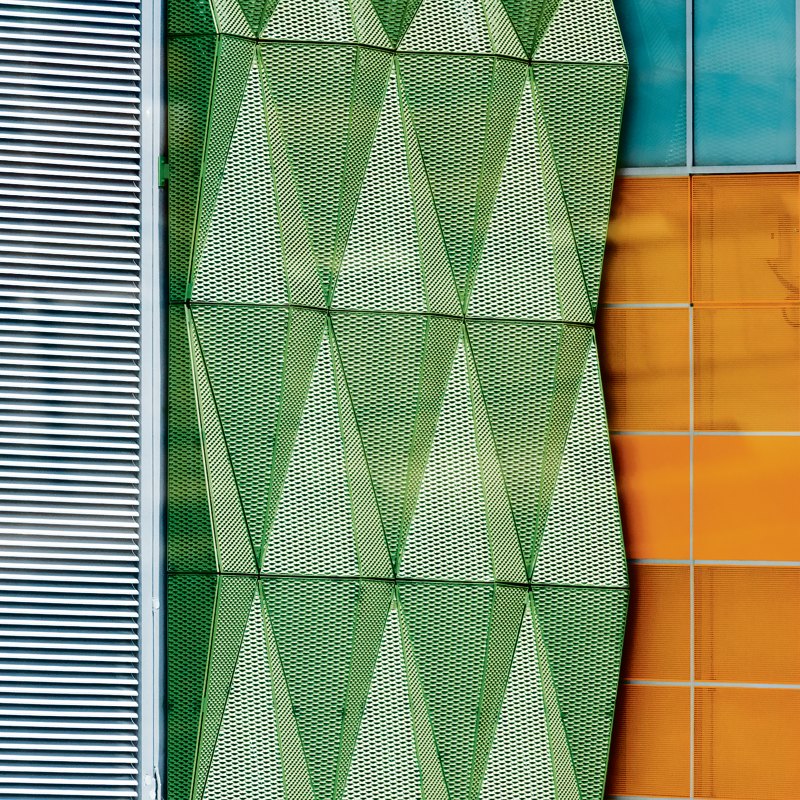
Viele Ökonomen, Politiker und Gewerkschafter halten eine Reindustrialisierung Frankreichs für dringend geboten. Nach der offiziellen Statistik ist der Anteil der Industrie an der Gesamtbeschäftigung (ohne Bauindustrie) im Zeitraum 1974 bis 2017 von 24,4 auf 10,3 Prozent gefallen, während der Anteil der Dienstleistungsjobs (und zwar der privaten wie der öffentlichen) bis 2017 bereits auf über 80 Prozent gestiegen ist.1
Die Industrie im engeren Sinne trägt heute nur noch 14 Prozent zur Wertschöpfung bei, also zur gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres. Deshalb mehren sich die Stimmen, die diese Entwicklung für eine Katastrophe halten.
Allerdings ist diese Entwicklung keinesfalls eine französische Besonderheit. Nach den Statistiken der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat der Industriesektor inklusive Baugewerbe mit 20 Prozent aller Beschäftigten in Frankreich immer noch einen höheren Anteil als in anderen Ländern, die in puncto Wachstum wohl kaum als Versager zu bezeichnen sind, wie Schweden, die USA, Kanada oder Großbritannien.
Und auch wo der Anteil der Beschäftigten im industriellen Sektor noch deutlich höher liegt, wie in Deutschland (27,3 Prozent) oder in Japan (23,9 Prozent), ist der Schwund dieser Jobs ähnlich ausgeprägt wie in Frankreich. Zwischen 1991 und 2018 sank der Anteil der Industriebeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung in Deutschland um 9,1 Prozentpunkte, in Japan um 10,3 und in Frankreich um 8,8 Prozentpunkte.2
Was sind also die Argumente der Industriefreunde? In dem Manifest „Redonnons la priorité à l’industrie“ (Der Industrie wieder Vorrang geben), das von rund 30 Wirtschaftswissenschaftlern, Politikern und Gewerkschaftsführern unterzeichnet wurde, heißt es kurz und knapp: „Die Industrie ist die treibende Kraft für alle Wirtschaftsaktivitäten, Forschung, Investitionen und letztlich Arbeitsplätze.“3
Doch wie soll ein Sektor, der in den reichen Ländern lediglich zwischen 8 und 20 Prozent der Arbeitsplätze respektive Wertschöpfung repräsentiert, die gesamte Wirtschaft einschließlich der Beschäftigung „antreiben“ können? Dieser Glaube beruht auf Theorien, die im 19. Jahrhundert von den klassischen Ökonomen und dann von Karl Marx entwickelt wurden: Reichtum schafft demnach nur die Industrie, Dienstleistungen dagegen entwickeln sich nur auf der Basis des von der Industrie geschaffenen Mehrwerts. Der Vorrang des Industriesektors begründet sich demnach aus ihrem „produktiven Charakter“, während die Dienstleistungen als „unproduktiv“ gelten.
Diese Auffassung wurde mit der Zeit durch weitere Postulate ergänzt. Für den Ökonomen Benjamin Coriat ist die Industrie eine „Gans, die goldene Eier legt“: Da sie höhere Produktivitätssteigerungen aufweise als die meisten Dienstleister, treibe sie das gesamtwirtschaftliche Wachstum an.
Eine weitere Behauptung lautet, auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft hänge allein von der Industrie ab, was früher einmal zutreffend gewesen sein mag. Dass dies aber heute nicht mehr unbedingt gilt, zeigt sich daran, dass die Bereiche Landwirtschaft und Dienstleistungen in allen Verhandlungen über Freihandelsabkommen eine sehr wichtige Rolle spielen. Gleichermaßen überholt ist das Argument, dass wichtige Innovationen nur im industriellen Sektor stattfinden.

Nostalgie der linken Industrialisten
Als Grund für den Rückgang der industriellen Beschäftigung wird oft die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland genannt. Doch in Frankreich lassen sich nur 10 bis 15 Prozent der Arbeitsplatzverluste darauf zurückführen.4 Das heißt: Auch wenn es gelingen würde, die Abwanderung in Billiglohnländer einzudämmen oder sogar zu verhindern, blieben 85 bis 90 Prozent des Problems weiter ungelöst.
Wenn Frankreich zwischen 1980 und 2017 rund 2,2 Millionen Arbeitsplätze im Industriesektor verloren hat, so sind dafür zwei andere Entwicklungen verantwortlich: Da ist zum einen die Verlagerung der privaten Nachfrage weg von Industriegütern hin zu Dienstleistungen. So ist im Zeitraum 1960–2017 der Anteil von langlebigen Gebrauchsgütern (Autos, Möbel, Haushaltsgeräte) und kurzlebigen Gütern (etwa Bekleidung) am Gesamtverbrauch der Privathaushalte von 22 Prozent auf 12,4 Prozent zurückgegangen.5
Als zweiter Faktor sind die Produktivitätssteigerungen im Bereich der Industrie zu nennen, die tatsächlich höher liegen als in den meisten Dienstleistungsbereichen. Die kombinierte Wirkung dieser beiden langfristigen Trends erklärt weitestgehend die schwindende Bedeutung der Industrie für die Beschäftigung. Und das gilt nicht nur in Frankreich, sondern nahezu weltweit, und vor allem auch in den BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika).6
Eine andere Erklärung für den Rückgang der industriellen Beschäftigung verweist auf drei Tendenzen, die mit der neoliberalen Globalisierung einhergehen: erstens die Intensivierung der Arbeit und zweitens die Konkurrenz von Ländern mit niedrigen Löhnen und ebenso niedrigen sozialen und ökologischen Standards. Letztere bewirkt die Verlagerung der Produktion ins Ausland und einen Anstieg des Konsums importierter Güter.
Der dritte Faktor ist die „Finanzialisierung“ von Unternehmen, die zu Betriebsschließungen oder dem Abzug von Investitionen führt. Was nicht etwa an mangelnder Wettbewerbsfähigkeit liegt, sondern an den enttäuschten Erwartungen der Anteilseigner, wenn die angestrebte Rendite von 10 bis 15 Prozent ausbleibt.
Aus Sicht eines „linken Industrialismus“, wie er vor allem von Ökonomen und Aktivisten im Umfeld der Arbeiterbewegung vertreten wird, sind diese drei Entwicklungen von Übel, weil sie immer wieder Unternehmen und sogar ganze Branchen in den Ruin getrieben haben. Diese Kritik ist nachvollziehbar, denn zweifellos hat die Industrialisierung über einen langen historischen Zeitraum hinweg zur Verbesserung der Lebensbedingungen beigetragen.
Aber es war eben nicht nur die Industrie, die ihren Anteil an dieser Entwicklung hatte: Eine ebenso wichtige Rolle spielten dabei – ab dem 20. Jahrhundert – öffentliche Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und Sozialfürsorge.
Und dann muss man auch die Gegenrechnung aufmachen: Die gefeierte Industrialisierung, die mit ihren hohen Produktivitätszuwächsen als Motor der Wirtschaftswunderjahre betrachtet wurde, hat spätestens seit den 1970er Jahren immense soziale, gesundheitliche und ökologische Schäden verursacht, die man als externe Effekte oder „Externalitäten“ bezeichnet.
Der ökologische Fußabdruck der Menschheit hat solche Ausmaße angenommen, dass er die Fähigkeit der Natur, die in der Produktion benötigten Rohstoffe bereitzustellen, zu überfordern beginnt. Und die Kohlenstoffemissionen haben bereits die Schwelle überschritten, an der die globale Erwärmung unumkehrbar geworden ist.
Nachhaltig produzieren, nachhaltig konsumieren
Und das bedeutet: Die Produktivitätsgewinne – nach dem Prinzip, immer mehr mit genauso viel oder sogar weniger Arbeit zu produzieren – haben sich vielfach in Verluste verwandelt, denn sie gehen zugleich auf Kosten lebenswichtiger Gemeingüter wie Klima, Wasser und nicht erneuerbarer Ressourcen wie Erze, fossile Brennstoffe und sogar Sand.
Die Verteidiger der Industrie sind zudem vollkommen blind für eine weitere menschliche, ökologische und gesundheitliche Katastrophe: 2017 waren in Frankreich im Agrarsektor (dem auch Waldwirtschaft und Fischerei zugerechnet werden) nur noch 750 000 Menschen beschäftigt, 1980 waren es noch 1,88 Millionen gewesen. Dies entspricht einem Rückgang um 60 Prozent, was deutlich über dem Beschäftigungsrückgang von 43 Prozent liegt, den die Industrie im selben Zeitraum zu verzeichnen hatte.
Hauptursache dieser Entwicklung ist die Industrialisierung der Landwirtschaft, die wiederum von zwei Faktoren vorangetrieben wird: von einer auf Produktionssteigerungen angelegten Agrarpolitik und von Freihandelsabkommen, die in Frankreich wie anderswo die kleinbäuerliche Landwirtschaft vernichten.
Hier ist also eine ganz ähnliche Entwicklung zu beobachten wie bei der „Industrialisierung“ des Handels – mit all den Einkaufszentren auf der grünen Wiese – und zahlreicher Dienstleistungen, die mittlerweile von seelenlosen Hightech-Fabriken erbracht werden. Industrialisierung mit dem Ziel ständiger Produktivitätssteigerungen bedeutet heute in den meisten Fällen eine Entmenschlichung der konkreten Tätigkeiten und katastrophale Auswirkungen auf unsere Umwelt und das globale Klima.
Dabei wäre eine andere Art der Industrie durchaus möglich, wenn man akzeptieren würde, dass ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung unwiderruflich abnimmt. Nun lässt sich eine Zukunftsvision für den industriellen Sektor (die auch auf andere Sektoren anwendbar wäre) zwar leicht proklamieren, aber nicht ganz so leicht konkretisieren. Generell brauchen wir eine neuartige Produktion materieller Güter, die den sozialen Bedürfnissen entspricht, zugleich aber präzise materielle und energetische Einschränkungen akzeptiert. Und zwar in Form von Grenzwerten, die nicht überschritten werden dürfen, damit die Welt bewohnbar bleibt.
Das gilt natürlich für die Klimaziele, sprich „Netto-null-Emissionen“7 (oder CO2-Neutralität) bis zum Jahr 2050, aber auch für die Biodiversität, deren Rückgang so schnell wie möglich gestoppt werden muss. Es gilt weiter für die Reduktion der dramatischen Umweltverschmutzung (CO2, Chemikalien, Plastik, um nur einige Problembereiche zu nennen), und schließlich brauchen wir einen effizienten Umgang mit nichterneuerbaren Ressourcen, die der thermoindustrielle Kapitalismus bislang mit unhaltbarer Geschwindigkeit verschlingt.8
Für die Umsetzung dieser allgemeinen Prinzipien ist es notwendig, konkrete und detaillierte Regeln für die nachhaltige Nutzung und Produktion der wesentlichen Industriegüter festzulegen, einschließlich der Energie in all ihren Formen. Es handelt sich um eine langfristige kollektive Aufgabe, die von einer öffentlichen Debatte begleitet sein muss und ein hohes Maß an fachlicher, sozialer und staatsbürgerlicher Kompetenz erfordert. Ein vorbildliches Beispiel – das einzige in Frankreich – bietet die Association NégaWatt, deren Szenarien auf dem Biomasse-Konzept „Afterres2050“ basieren, das die Organisation Solagro entwickelt hat.9
Eine der zahlreichen Studien dieser Gruppen, die keine ehernen Wahrheiten, sondern Denkanstöße liefern wollen, betrifft die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und wie die Industrie ihnen entsprechen sollte. Ausgangspunkt ist dabei eine deutliche Verringerung der Autoabhängigkeit bis 2050. In Frankreich zum Beispiel geht noch immer jede vierte Autofahrt über weniger als drei Kilometer; von den Leuten, die weniger als einen Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen, fahren mehr als die Hälfte mit ihrem Auto dorthin; die öffentlichen Verkehrsmittel sind unzureichend und teuer.
Unter diesen Umständen, so folgern die Autoren der NégaWatt-Studie, ist eine größere Effizienz der Nutzung viel entscheidender als ein Umsteigen auf – ohnehin ökologisch bedenkliche – Elektro- oder Hybridfahrzeuge (auf die Hersteller wie Politiker bislang setzen). Das wäre keineswegs das Ende von Innovationen, aber die wären auf sparsamere Autos gerichtet statt auf immer PS-stärkere Modelle.
Konkret soll bis 2050 die pro Kopf mit dem Privatfahrzeug zurückgelegten Strecke halbiert werden, und zwar zugunsten viel umweltfreundlicherer Verkehrsmittel. Die Autos hätten eine viel längere Lebensdauer und würden hauptsächlich mit erneuerbarer Energie betrieben. Der Anteil der Benzin- und Dieselfahrzeuge soll bis dahin auf 10 Prozent sinken (2019 sind es noch 90 Prozent); der Durchschnittsverbrauch auf drei Liter pro 100 Kilometer reduziert werden. Und auch die Höchstgeschwindigkeit würde reduziert.
Dank Fahrgemeinschaften könnte die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Fahrzeug von heute 1,6 auf 2,4 steigen. Die Autohersteller sollen vermehrt recycelte Materialien verwenden; außerdem sollen sie ihr Geschäftsmodell um die Umrüstung älterer Modelle und um Vermietung erweitern. Dadurch könnten sie ihren Energieverbrauch halbieren und den Stahlverbrauch reduzieren. Zusätzlich könnten sie sich stärker auf die Ausrüstung von öffentlichen Verkehrsmitteln (einschließlich Eisenbahnverkehr) und die Produktion von Fahrrädern (auch elektrischen) konzentrieren.
All das sind keine Luftschlösser. Die NégaWatt-Studien enthalten Bilanzen und quantifizierbare Prognosen für alle Bereiche und Produkte, von Energie bis Bauen, von Heizungstechnik über Haushalts- und Elektrogeräte bis hin zu Lebensmitteln. Und für alle untersuchten Bereiche gibt es eine Bewertung der plausiblen Prognosen, die auch die wahrscheinlichen Effizienzsteigerungen sowie das Potenzial für Energie- und Materialeinsparungen berücksichtigen.
Nach diesen Szenarien wird das Ziel, andere Dinge auf andere und schonendere Weise zu produzieren, auch dadurch erreicht, dass sich die industrielle Produktion und der Verbrauch auf nachhaltige, reparierbare, wiederverwendbare und – wo immer möglich – auf gemeinsam genutzte Produkte ausrichten. Das soll durch Anreize, vor allem aber durch Gesetze erreicht werden.
Dieses Konzept berührt eine andere Zukunftsvision, die auf den Erhalt unseres Planeten gerichtet ist: die sogenannte Low-Tech-Strategie, die auf sparsamere und einfachere, dabei aber keinesfalls weniger innovative Technologien setzt.
Ein Vordenker der wachsenden Low-Tech-Bewegung ist Philippe Bihouix. Er schreibt in seinem Aufsatz über den „Mythos der rettenden Technologie“: Um Ressourcen so effektiv wie möglich zu recyceln und die Lebensdauer unserer Dinge zu erhöhen, „müssen wir diese von Grund auf neu denken“.10 Und zwar „lebensgerecht“, wie Ivan Illich es genannt hätte: „einfach und robust, reparabel und wiederverwendbar, standardisiert, modular, aus einfachen Elementen bestehend, leicht zu zerlegen, unter sparsamster Verwendung seltener und unersetzlicher Rohstoffe wie Kupfer, Nickel, Zinn oder Silber und mit möglichst wenig Elektronik.“
Völlig neu denken müsse man auch die Produktionsmethoden: „Die Fertigungsstätten sollen bevorzugt in räumlicher Nähe zu den Verbrauchern angesiedelt werden, sie sollten vielleicht etwas weniger produktiv sein und dafür arbeitsintensiver, weniger mechanisiert und robotisiert, aber dafür ressourcen- und energieeffizienter. Und sie sollten eingebunden sein in ein Netzwerk von Wiederverwertung, Reparatur, Weiterverkauf und Teilen oder ‚Sharing‘ von Alltagsgegenständen.“
Hier wird nicht etwa die Rückkehr in eine industrielle Vergangenheit vorgeschlagen, die ebenso mystifiziert wird, wie sie umweltschädlich war. Eine alternative Industrialisierung, die das Schlimmste verhindern könnte, erfordert viele Innovationen. Aber was gebraucht wird, sind eben keine hypertechnologischen Entwicklungen, sondern lediglich einige der schon vorhandenen Technologien, die es noch zu verbessern gilt, insbesondere um die Nutzung von Energie und Rohstoffen effektiver zu machen.
Es stellen sich allerdings zwei wichtige Fragen: Welche Bedeutung wird die Industrie künftig noch für die Gesamtwirtschaft haben? Und wie wird die Gesellschaft auf den sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie wie auch auf die Transformation von Produktion und Beschäftigung reagieren?
Zweifellos würde die Bedeutung der Industrie für die Beschäftigung insgesamt zurückgehen, auch wenn einige Branchen einen erheblichen Aufschwung erfahren dürften. Aber diese Entwicklung wäre weit weniger dramatisch als die, die wir schon seit Jahrzehnten erleben. Und das aus zwei Gründen: Zum einen, weil die wirtschaftliche Tätigkeit viel weniger auf Produktivitätssteigerungen ausgerichtet wäre, durch die so viele Arbeitsplätze – nicht nur in der Industrie – vernichtet wurden und werden. Und zum anderen, weil die unumgängliche Neuverhandlung des Welthandelsregimes die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland zumindest bremsen würde.
Eine Million Arbeitsplätze in klimafreundlichen Branchen
Aus dem Szenario von NégaWatt ergeben sich einige Hinweise darauf, in welchen Branchen wahrscheinlich neue Arbeitsplätze entstehen werden. Als schlagendstes Beispiel wird der Bereich erneuerbare Energien genannt, in dem in Frankreich bis 2030 mehr als 330 000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Weitere Beispiele nennt die Plattform Emplois-climat, ein Zusammenschluss von 16 Verbänden und Gewerkschaften, dem zahlreiche Wissenschaftler zuarbeiten.11
In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Un million d’emplois pour le climat“ werden die künftigen Wachstumsbereiche aufgelistet, wie etwa ökologische Baustoffe, Transportvehikel für einen sanften, emissionsarmen Verkehr, thermische Sanierung von Gebäuden und vieles mehr.
Während die Beschäftigung im industriellen Sektor zwischen ihrem historischen Höchststand 1974 und 2016 um 46 Prozent geschrumpft ist, gibt es einige wenige Branchen, die sogar expandieren konnten.12 Das stärkste Beschäftigungswachstum (auf mehr als das Doppelte der Arbeitsplätze) verzeichneten die Bereiche Trinkwassergewinnung und -verteilung, Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung. Sie beschäftigen inzwischen deutlich mehr Leute als die Bereiche Strom,- Gas- und Fernwärmeversorgung sowie Gebäudeklimatisierung, in denen die Beschäftigung im selben Zeitraum fast unverändert blieb.
Die beiden letztgenannten Bereiche dürften jedoch aufgrund der wachsenden Bedeutung von Recycling und Umweltsanierung (wo künftig auch der Abbau von AKWs anfällt) und aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien ein starkes Wachstum erfahren. Diese zusätzlichen Aktivitäten sollten möglichst auf lokaler Ebene verbleiben – also außer Reichweite der multinationalen Unternehmen, die sie womöglich nur auslagern würden.
Mit der Umsetzung des geschilderten Szenarios würde sich unser Lebensstil sicher dramatisch ändern. Aber das Bekenntnis zur Genügsamkeit und gegen den Konsumismus bleibt eine hohle Phrase, solange wir uns nicht damit auseinandersetzen, welche sozialen Gruppen aufgefordert wären, ihr Verhalten im Namen des allgemeinen Interesses am stärksten zu ändern.
Eine ähnliche Frage stellt sich in puncto Umweltschutz und Besteuerung. Auch hier geht es darum, ob die Belastungen gerecht oder ungerecht ausfallen. Derzeit emittieren die Superreichen 30- bis 40-mal mehr Treibhausgase als die ärmsten 10 Prozent der Bevölkerung (bezogen auf Frankreich), aber diese werden durch die heutigen CO2-Steuern 4-mal so stark belastet.13 Um die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen im Sinne des Energie- und Ressourcensparens zu erhöhen, müssten vor allem solche Ungerechtigkeiten beseitigt werden.
Und schließlich wird es für die Akzeptanz der Veränderungen von Arbeit und Beschäftigung entscheidend darauf ankommen, dass die berufliche Zukunft der Beschäftigten, deren derzeitige Arbeitsplätze bedroht sind, im gleichen oder in einem ähnlichen Bereich gesichert ist.
In der ganzen Debatte muss aber auch immer wieder auf ein wichtiges positives Faktum verwiesen werden: Das Ende des Hightech-Wahnsinns und des besinnungslosen Strebens nach immer höherer Produktivität würde für viele Menschen endlich positive Perspektiven eröffnen; zum Beispiel, weil sie bessere Arbeitsbedingungen erwarten könnten. Vor allem aber, weil sie eine sinnvollere produktive Tätigkeit ausüben würden, die dazu beiträgt, die Zukunft der Gesellschaft zu sichern.
2 World Bank, Employment in Industry, https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS.
5 „Les Comptes de la nation en 2017“ (siehe Anmerkung 1).
8 „Global Resources Outlook 2019“, Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), Nairobi 2019.
10 „Le mythe de la technologie salvatrice“, Esprit, März/April 2017.
12 Siehe die Daten von Insee, www.insee.fr.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert
Jean Gadrey ist Honorarprofessor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Lille und Autor von „Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire“, Paris (Alternatives économiques – Les petits matins) 2010.




