Mista’aravim oder die vertane Chance
Der Nahostkonflikt aus der Sicht eines jüdisch-israelischen Arabisten
von Yonatan Mendel
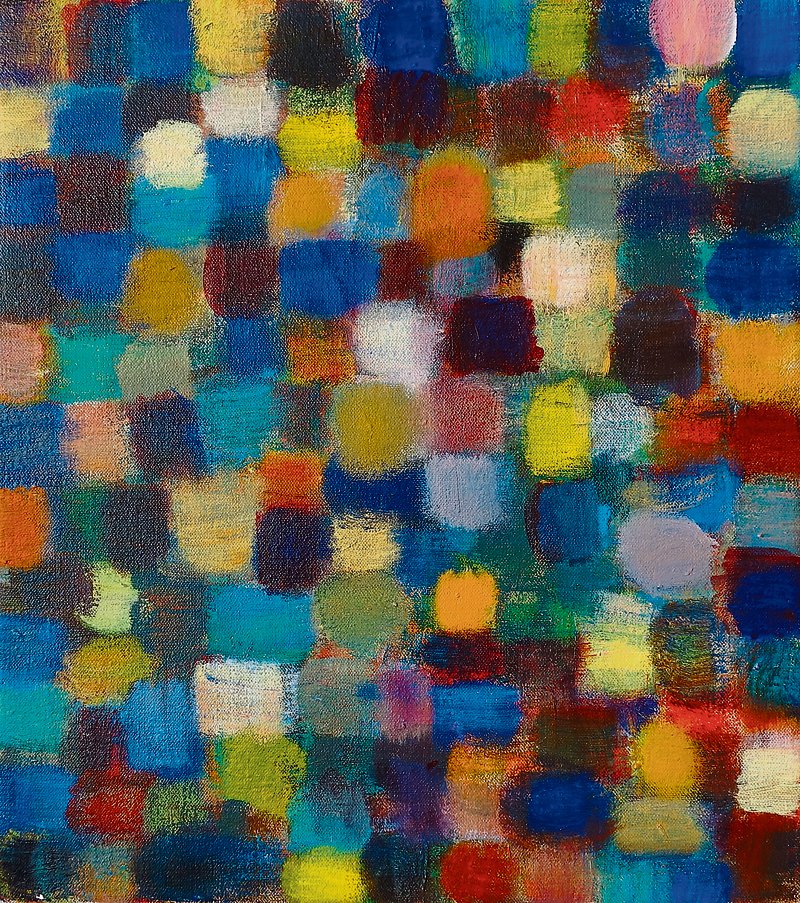
Es war am ersten Tag des Eid al-Fitr, des Fastenbrechenfests am Ende des Ramadan. Ich saß nach einem Basketballspiel mit einem Bänderriss im Tel Aviver Sourasky-Krankenhaus und wartete auf die Röntgenuntersuchung. Da betraten zwei junge Palästinenser das Wartezimmer, einer von ihnen humpelte genau wie ich. Wir begannen eine Unterhaltung, zuerst auf Hebräisch, dann wechselten wir ins Arabische.
Als Erstes stellten sie die übliche Frage: „Warum sprichst du Arabisch?“ Und ich gab die üblichen Antworten: „Ich übersetze aus dem Arabischen, schreibe über Arabischunterricht an israelischen Schulen und die Geschichte des Arabischen in Israel. Ich habe arabische Freunde, mit denen ich zusammenarbeite, und habe früher auch bei Menschenrechtsorganisationen in den besetzten Gebieten gearbeitet.“ Nur meine Militärzeit beim Nachrichtendienst in den 1990er Jahren erwähnte ich nicht.
Der Verletzte kam aus Nablus, habe „aber eine Arbeitserlaubnis“, wie sein Cousin mehrmals betonte. Als Arabisch sprechender jüdischer Israeli gehörte ich für sie zum Establishment, mit dessen Vertretern man lieber vorsichtig umgeht. Sie lächelten bitter, als sie über die bevorstehenden Feiertage sprachen. Ein paar Tage zuvor war auf der israelischen Baustelle, wo er arbeitete, ein Zementmischer auf den jungen Palästinenser gestürzt.
Er nutzte die Gelegenheit, um mich zu fragen, was er wegen seiner Verletzung machen solle – und auch wegen seines Bruders, der versuche eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Ich gab ihm die Telefonnummern von Physicians for Human Rights und der israelischen NGO Legal Center for Freedom of Movement (Gisha). Er fragte auch nach meiner Nummer. Ich gab sie ihm. Er rief mich an und legte auf. Jetzt hatte er meine Nummer und ich seine.
Der Krankenpfleger, der die Szene vom anderen Ende des Wartezimmers aus beobachtete, hatte nicht viel von dem verstanden, was wir gesprochen hatten. Was er sah, war ein aschkenasisch-israelischer Mann, der mit einem Palästinenser aus dem Westjordanland ein Gespräch auf Arabisch führte, an dessen Ende Telefonnummern ausgetauscht wurden. Nachdem die beiden Palästinenser zu einer weiteren Röntgenuntersuchung gerufen wurden, kam er zu mir und fragte: „Und? Hast du ihn rekrutiert?“

Als Araber getarnt im Feindesland
Die Frage mag in ihrer Direktheit plump erscheinen, aber im heutigen Israel ist sie überhaupt nichts Besonderes. Der Zionismus und der darauf gründende Staat Israel haben zwischen jüdischen Israelis und Arabern – egal ob Palästinenser, Ägypter, Jordanier oder Syrer – ein Klima des Misstrauens geschaffen, in das sich in unterschiedlicher Dosierung Machismus, Militarismus, Feindseligkeit, Heldenverehrung, Exotismus und Romantisierung mischen. Solche Verhaltensmuster legt aber nicht nur der gewöhnliche Israeli an den Tag, der mit Stereotypen aufwächst, wie sie etwa Ehud Baraks Klischee von Israel als „Villa im Dschungel“ transportiert oder Sayed Kashuas Sitcom „Arab Labor“.
Auch die jüdischen Israelis, die „Araber kennen“ und jener „Zunft“ angehören, die Arabisch studiert hat und einen Abschluss in Nahoststudien besitzt, sind dafür anfällig. Sie kommentieren die Ereignisse in der arabischen Welt, arbeiten im Außen- oder Verteidigungsministerium, flanieren durch arabische Städte und verfolgen die arabischen Medien. Sie haben Jobs im Bereich „Arabische Angelegenheiten“, arbeiten für den Geheimdienst oder sind als „Mista’aravim“ – „als Araber getarnt“ – im Einsatz.1 Es sind die Leute, die Araber zugleich lieben und hassen und Klischees zusammenbrauen wie die „Villa im Dschungel“ oder „Arab Labor“.
Die jüdische Bevölkerung Israels hat gelernt, die Eigenheiten dieser Gemeinschaft von Vermittlern – den „Experten“ in Sachen Araber – zu akzeptieren; eine Gemeinschaft, deren Mitglieder meist einen ähnlichen Ausbildungsweg durchlaufen haben: Arabische Studien in der Oberschule, Armeezeit beim Geheimdienst, Uniabschluss am Institut für Nahoststudien oder in Arabischer Sprache und Literatur und dann „Ausschwärmen“ in verschiedene Felder – sei es eine Anstellung im Außen- oder Verteidigungsministerium, in den Medien, bei halbakademischen Thinktanks oder als Teil einer neuen Generation von „Arabisten“, die an Oberschulen unterrichten.
Bereits 1956 wurde das Orientstudienprogramm als Kooperationsprojekt zwischen der Armee, den Sicherheitsdiensten und dem Bildungsministerium eingerichtet. Auf Exkursionen in arabische Dörfer sollten die Studierenden „arabisches Leben und arabische Kultur“ kennenlernen. Shmuel Divon, Berater für Arabische Angelegenheiten unter Ministerpräsident David Ben-Gurion (1955–1963), erklärte damals dem Bildungsminister, warum der Staat Israel dieses Studienfach braucht:
„Das Programm wird aufgrund des akuten und zunehmenden Mangels an Arabisch sprechendem Personal in Regierungseinrichtungen und der Armee eingerichtet. Unser Ziel ist es, junge Menschen nach ihrem Schulabschluss weiterzubilden. Während ihrer Armeezeit werden diese jungen Leute zusätzlich in arabischen Themen ausgebildet. So wird ihre praktische Spezialisierung in Feldern mit Bezug zu den Arabischen Angelegenheiten sichergestellt. Nach ihrem Armeedienst werden geeignete Absolventen ihre Ausbildung am Institut für Nahoststudien an der Universität fortsetzen.“2
Genauso sieht seitdem die Laufbahn eines durchschnittlichen Arabisten in Israel aus, die ihn in den Augen der jüdischen Öffentlichkeit zum „Experten für Arabische Angelegenheiten“ macht. Dabei halten es alle für selbstverständlich, dass die Experten auf diesem Feld ausschließlich jüdisch sind. Es ist zum Beispiel undenkbar, dass der Kommentator eines israelischen TV-Senders für „Arabische Angelegenheiten“ ein Araber ist oder ein arabischer Dozent als Experte für ein bestimmtes nahöstliches Land auftritt.
Die israelisch-jüdischen Arabisten wurden zu allwissenden Orakeln und Helden stilisiert, die imstande sind, in die „arabische Seele“ zu blicken und jederzeit eine Antwort parat haben – sei es zu arabischer Geschichte, sozialen Fragen, politischen Hoffnungen, seelischen Befindlichkeiten oder zur Entwicklung ihres Forschungsgegenstands.
Der palästinensische Bauer als Quelle der Inspiration
Aus israelischer Sicht sind diese Vermittler und Experten komplett unparteiisch. Und sie gelten als unbefangen, weil sie die Situationen, die sie beschreiben, nicht mit israelischer Politik in Verbindung bringen würden und vor allem: weil sie keine Araber sind.
Anders gesagt: Zwischen der jüdisch-israelischen Öffentlichkeit und den Vermittlern in Sachen „arabische Angelegenheiten“ herrscht das stillschweigende Abkommen, dass in den Medien nur Informationen akzeptiert werden, die in die bekannten Kategorien eingeordnet werden können. Der Sicherheitsabstand zwischen „Juden“ und „Arabern“, „gut“ und „böse“, „rational“ und „unberechenbar“, zwischen jenen, die leben wollen, und jenen, denen es nichts ausmacht, zu sterben, gehört frei nach Edward Saids binärem oriental gap zum allgemeinen Konsens.
Die Figur des Mista’aravim wurde zum Symbol: Soldat, männlich, heldenhaft und jüdisch; und zugleich vertraut mit Arabern. Versteckt hinter einer Kufija, kehrt er mit geheimnisvollen Geschichten im Gepäck von seinen Ausflügen in die arabische Welt zurück. Er kommt den Arabern so nah wie möglich, ist aber zugleich das genaue Gegenteil – die Essenz des Israelischseins. Doch die Mista’aravim haben dieses Image nicht erfunden. Es war der Zionismus, der in seinen Anfängen das osteuropäische Ghetto hinter sich lassen und die jüdischen Immigranten im Land verwurzeln wollte.
Für die Bilu-Pioniere,3 die man auf den Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts auf ihren Feldern hocken und vespern sieht, war der palästinensische Bauer eine Quelle der Inspiration. Und die Dschallabijas und die Schwerter, mit denen sich die Mitglieder der jüdischen Bürgerwehr Hashomer4 fotografieren ließen, waren keine aus Russland importierte Tracht.
Das Gleiche gilt für die Mitglieder der 1941 gegründeten paramilitärischen Einheiten des Palmach: Je besser sie Arabisch sprachen, je „authentischer“ („asli“) ihre Kufija, je lokaler („baladi“) ihr Essen, desto angesehener waren sie. Denn je „arabischer“ sie waren, umso geeigneter waren sie, die Araber zu ersetzen und schließlich deren Grundherren zu werden.
Der Palmach-Kämpfer Netiva Ben Jehuda erinnert sich an die Einstellung gegenüber den Arabern in den 1940er Jahren wie folgt: „Wir betrachteten sie als Inbegriff der Einheimischen, und wir, wir wollten arabisch wirken. Wer sich auf Arabisch unterhalten konnte, den bewunderten wir. Und hatte jemand arabische Freunde, war er ein König, ein echter König. Ein Beduine genügte, selbst ein armer, ungepflegter Träger aus dem Hafen von Jaffa. Und je mehr einer von uns wusste über arabische Bräuche, wie man sich unter ihnen bewegt, wie man sich wie sie verhält und eine gemeinsame Sprache findet – desto mehr war er in unseren Augen ein Gott.“5
Die Mista’aravim zur Zeit des britischen Mandats (1920–1948) kann man jedoch nicht mit den Mista’aravim von heute vergleichen, die größtenteils erst in der Armee Arabisch lernen und bei ihrer ersten Begegnung mit Palästinensern verdeckt eine Waffe tragen.
Die Mista’aravim des Palmach waren hingegen arabische Juden, arabische Muttersprachler, die mit Arabern in arabischen Ländern aufgewachsen waren. Deshalb mussten sie ihre Loyalität zur zionistischen Sache auch immer extra unter Beweis stellen und sich den aschkenasischen Juden unterordnen, die letztlich alles entschieden.
In seinem Buch „Die Mista’aravim des Palmach“, beschreibt Tzvika Dror das Machtgefälle zwischen den unterschiedlichen Einheiten: „Damals definierte jemand den geeigneten Typ Mann, um in der Mizrahi-Einheit zu dienen: ‚Außen schwarz und innen weiß‘. “6 Die Mitglieder der Einheit wurden „Shehorim“ genannt („Schwarze“). Erst als einige von ihnen merkten, dass das eine abfällige Bezeichnung war, forderten sie, den Namen in „Shahar“ („Morgenröte“) zu ändern.
„Du musst wissen, wie man auf einem Stuhl sitzt, wenn man Wasserpfeife raucht, wie man beim Backgammon-Spiel flucht, wie man ein Haus betritt, wie man den Kellner ruft, wie man bezahlt und wie man Schuhe poliert. Du musst die Ausdrücke der Bauern lernen, und auch, wie man auf dem Boden schläft und Läuse hat.“7
Die jungen Mista’aravim des Palmach waren in Bagdad, Sanaa, Hebron oder Damaskus geboren und aufgewachsen. Beim Training in ihrer Einheit wurden sie in die Erwachsenenwelt der Araber eingeführt, lernten, wie Muslime und Christen beten, und übten nationalistische palästinensische Lieder.
Die Tarnung, die den Mista’aravim beim Palmach beigebracht wurde, zerstörte aber auch das, was sie hätten sein können. Denn ihre vormilitärischen Erfahrungen – ihre Muttersprache, ihr Aufwachsen mit Arabern, arabischer Kultur, arabischen Freunden und Nachbarn – hätten eine Chance für die jüdisch-arabische Koexistenz sein können, ein Bindeglied zwischen arabischen und jüdischen Kulturen. Doch von dem Moment an, wo sie rekrutiert und von der zionistischen Bewegung entsendet wurden, um mit gefälschter Identität in die arabische Gesellschaft einzutauchen, war dieses Potenzial für immer verloren.
Anders gesagt: Genau der Akt des sich „als Araber“ verkleiden war die endgültige Internalisierung der dominanten europäisch-zionistischen Einstellung, die Juden von Arabern unterscheidet und trennt. Die Notwendigkeit, dass sich der arabische Jude als Araber verkleiden muss, ist Beweis genug, dass er im Kern kein Araber ist. Und so waren es die Mista’aravim, die eine wahrhaft unheilige Dreieinigkeit vorantrieben: sich den Arabern zu nähern, den Arabern zu schaden und nicht Araber zu sein. Zur Belohnung bekamen sie Ausweise mit dem Eintrag „Sabra“ – die Bezeichnung für in Eretz Israel geborene Juden.
Der Begriff Mista’aravim hat mehrere Ursprünge. Da ist zunächst das arabische Wort musta’ribun, mit dem alte jüdische Gemeinden in der Region bezeichnet wurden (Al-Jahud al-must’riba), die Arabisch sprachen und Teil der dominanten arabischen Kultur waren. Dieser Ursprung verbindet den modernen hebräischen Ausdruck mit dem arabischen ista’raba für „sich den arabischen Sitten anpassen“, „sich Arabisieren“, der seine Entsprechung im hebräischen Wort hishta’rev hat.
Doch es gibt noch zwei weitere Hypothesen zum Ursprung des Worts „Mista’aravim“ beziehungsweise „Hista’aravut“ (das entsprechende Verbalsubstantiv). Die eine verbindet das hebräische Wort für „angreifen“ (hista’er) mit dem Wort „Araber“ (Arav), betont also den Akt des „Angreifens“. Die zweite kombiniert das Wort „Araber“ mit dem hebräischen Ausdruck für „getarnt/verkleidet“ (histava), legt den Akzent also auf den Akt des Maskierens, um erfolgreich als Araber „durchzugehen“.
Das Stereotyp von Israel als „Villa im Dschungel“
Mit der Zeit wurden die Mista’aravim Teil der israelischen DNA, sowohl im Bereich der nationalen Sicherheit als auch im zivilen Leben. Für die Verteidigung wurden verschiedene Mista’aravim-Einheiten gebildet, die zum Teil immer noch aktiv sind, etwa das Schaked-Kommando (Gaza, 1970er Jahre), die Shimshon-Division (Gazastreifen, 1980er/1990er), die Hermesh-Einheit (Westjordanland, 1990er Jahre), Jechidat Duvdevan (aktuell die Haupt-Mista’aravim-Einheit der IDF), Yamas (die Mista’aravim-Einheit der israelischen Grenzschützer), Gideonim (die Mista’aravim-Einheit der israelischen Polizei), Masada (die Mista’aravim-Einheit für israelische Gefängnisse) und andere Einheiten beim Mossad und bei den Sicherheitsdiensten, deren verdeckte Operationen eine solche Tarnung beinhalten.
Allerdings sind die Spuren, die sie im zivilen Leben hinterlassen, in vieler Hinsicht erhellender. Der große Erfolg der TV-Serie „Fauda“ über eine Mista’aravim-Einheit ist kein Zufall. Wenn die Titelhelden den Song „Tamali Ma’ak“ („Immer mit dir“) von Amr Diab anstimmen, ist das der Moment, der uns sagen soll: Schaut her, hier sind sie, unsere besten Söhne, wie sie ein ergreifendes Lied anstimmen und dazu die Saiten der Gitarre schlagen; eine Personifizierung höchster Moral und heiligen Märtyrertums. Sie schaffen es sogar, das Arabische menschlich erscheinen zu lassen; sie „retten“ es gewissermaßen vor den Barbaren. Diese Mista’aravim-Version eines ägyptischen Songs wurde auf YouTube über eine halbe Million Mal angeklickt.
Man fragt sich, was wohl die ägyptischen Urheber des Songs darüber denken und ob das Copyright honoriert wurde. Jedenfalls offenbart die Beliebtheit dieser Form des Mista’aravim-Arabismus einen wichtigen Aspekt moderner israelischer Identität: das Motiv der zum Frieden ausgestreckten Hand, das Zugehen auf den arabischen Feind und gleichzeitig die Aufrechterhaltung einer physischen, politischen und geistigen Grenze.
Die Israelis lieben ihre Mista’aravim-Helden. Das hat auch der israelische TV-Sender Channel 10 verstanden, vor allem wegen Zvi Yehezkeli. Die Fernsehserie des Journalisten, in der er seine eigene Form des „Hista’aravut“ praktiziert, war überaus erfolgreich. Zwar ist es schwer zu überprüfen, wie viele seiner Gesprächspartner ihn tatsächlich für einen Palästinenser aus einem Flüchtlingslager halten, aber die Show ist ohnehin weniger dazu da, dem Araber zuzuhören, als die Einschaltquote zu erhöhen.
All die „gruseligen“ Situationen, in denen ein israelischer Mann im Flugzeug neben einer verschleierten Frau sitzt oder „undercover“ unter seiner Kufija an gefährliche Orte reist, legen Zeugnis ab über uns als Gesellschaft, über die Art und Weise, wie wir uns dem Nahen Osten vermitteln, und darüber, was wir entscheiden, zu tun und zu sehen.
Im Stereotyp von Israel als „Villa im Dschungel“ haben die Mista’aravim und der Akt des Hista’aravut – ob im militärischen Kontext oder als Objekt der Verehrung – längst die Grenzen ihrer Sicherheitsfunktion überschritten. Sie gehören in die Geschichte des Zionismus und in die Militärdoktrin im Anschluss an die Arabische Revolte von 1929. Zahlreiche Legenden ranken sich um sie, vom Palmach über die heutige Armee, sie sind Thema in der zeitgenössischen Literatur, in Fernsehserien, in traurigen Liedern mit Gitarrenbegleitung, aber auch im Alltag der meisten jüdischen Israelis.
Beim Aufnahmegespräch in die Armee zum Beispiel wissen die potenziellen Soldaten natürlich, was sie auf die Frage, ob sie arabische Freunde haben, antworten müssen: Normalerweise haben sie keine, und wenn doch, verraten sie es nicht. Hier zeigt sich eine andere Form des „Hista’aravut“. Auf der anderen Seite wird ein israelischer Zivilist, der beim Militär oder einem Sicherheitsdienst Arabisch gelernt hat, dies gegenüber einem Araber niemals sagen. Auch hier finden sich Spuren des „Hista’aravut“.
Es gibt auch eine exotische Form des „Hista’aravut“. Früher manifestierte sie sich in dem Wunsch, die roten Felsen im jordanischen Petra zu sehen und heil zurückzukehren. Später wurde daraus die Friedensmetapher vom „Hummus-Essen in Damaskus“. Dieses Bild war so stark, dass Ministerpräsident Ehud Olmert 2007 nicht zögerte, ein Paket zu öffnen, das aus dem Palast von Baschir al-Assad kam: frischer Hummus aus Damaskus, ein Mitbringsel, überbracht durch den US-amerikanischen Gesandten. Unverzüglich verkündete Olmert: „Ich habe angeordnet, dass das Paket direkt in mein Büro gebracht wird, ohne Sicherheitscheck.“
Je weiter das arabische Dorf oder die palästinensische Stadt entfernt ist, aus der unser Hummus kommt, umso besser. Es ist schließlich nur Hummus, allerdings von der Sorte, die israelische Herzen, die alle einen kleinen Mista’aravim in sich tragen, höher schlagen lässt.
Solange Israel an seiner Einstellung gegenüber der arabischen Welt festhält und die israelischen Mittler zur arabischen Welt in ihrem Gehäuse verharren; solange wir die „Ostoption“ – eine Öffnung nach Osten – ausschließen, solange wir Arabisch nur in einem Wahlfachkurs für Geheimdienstrekruten lernen und solange diese Mischung aus Machismus, Militarismus, Feindseligkeit, Heldenverehrung, Exotismus und Romantisierung bei jedem Zusammentreffen von Juden und Arabern im Raum schwebt – so lange werden wir unter dem Fluch der Mista’aravim leben.
Zuweilen kommt es einem so vor, als ob diejenigen, deren Beruf es ist, die Araber zu „kennen“, dieselben sind, die unsere letzte Chance, hier zu leben, zunichtemachen. Sie signalisieren den Arabern, dass sie sich vor allen Juden in Acht nehmen sollen, und den Juden, dass sie vor allen Arabern Angst haben sollen. In der Welt, die sie uns präsentieren, sind sie die unantastbaren Vermittler; aber es ist eine Welt, in der Israel und die Israelis als Fremdkörper in einer arabischen Umgebung wahrgenommen werden.
Die Brille, die sie uns aufsetzen, hindert uns daran, die Welt anders zu betrachten: Anstelle eines arabischen Juden sehen wir einen potenziellen Spion; anstelle eines Arabisch sprechenden Juden sehen wir einen potenziellen Anwerber arabischer Kollaborateure; anstelle eines Menschen sehen wir eine existenzielle Bedrohung. Deswegen bleiben uns nur zwei Optionen: Entweder bleiben wir Mista’aravim, oder wir leben.
5 Netiva Ben Yehuda, „1948 – Between Calendars“, Jerusalem (Keter) 1981 (Hebräisch).
6 Tzvika Dror, „The Mista’aravim of the Palmach“, Tel Aviv (Hakibbutz Hameuchad) 1986 (Hebräisch).
7 Tzvika Dror, siehe Anmerkung 6.
Aus dem Englischen von Jakob Farah
Yonatan Mendel ist Direktor des Zentrums für jüdisch-arabische Beziehungen am Van-Leer-Institut in Jerusalem. Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in „The Guide to the Arab World“, dem Begleitband zu der Ausstellung „Tamir Zadok: Art Undercover“ (kuratiert von Noa Rosenberg, Tel Aviv Art Museum, 19. September 2017 bis 18. März 2018). Die englische Fassung (übersetzt von Sivan Raveh) steht auf der Webseite von The Forum For Regional Thinking, http://www.regthink.org/en/articles/the-arabists-jungle-an-israeli-arab-affair.
© Yonatan Mendel; für die deutsche Übersetzung LMd, Berlin



